
In den letzten zwanzig Jahren ist in den fünf grössten Agglomerationen der Schweiz der Anteil neu erstellter Wohngebäude innerhalb der bestehenden Siedlungsfläche merklich gestiegen. Besonders in den Städten werden neue Wohnungen in erster Linie durch Ersatzneubauten, Aufstockungen oder durch die Umnutzung ehemaliger Industrie- und Gewerbezonen geschaffen – und kaum mehr auf bisher unbebautem Land.
Während zu Beginn der 2000er-Jahre Ersatzneubauten oder Umnutzungen von Industrieflächen noch selten waren, machen sie heute je nach Agglomeration bis zu 63 Prozent der Neubauten aus. Insbesondere durch die Umzonung von Industrie- und Gewerbeflächen konnte viel zusätzlicher Wohnraum geschaffen werden. Zu diesem Ergebnis kommt eine Studie der Forschungsgruppe Raumentwicklung und Stadtpolitik (SPUR) von David Kaufmann, Professor der ETH Zürich. Ein Beispiel ist Basel: Dort entstanden zwischen 2020 und 2023 rund 15 Prozent der neuen Wohngebäude auf früheren Industrie- oder Gewerbezonen; in diesen Gebäuden befinden sich sogar rund 24 Prozent aller neuen Wohnungen.
Trotz weniger Neubauten mehr Wohnungen - dank Verdichtung
Trotz eines leichten Rückgangs der Zahl neugebauter Wohnhäuser hat die Netto-Wohnungszunahme (neu gebaute abzüglich abgebrochene Wohnungen) in den meisten Agglomerationen zwischen 2020 und 2023 zugenommen. Diese bauliche Verdichtung erfolgt mehrheitlich durch Ersatzneubauten. Die Verdichtung zeigt sich jedoch unterschiedlich stark zwischen den Agglomerationen. Besonders effizient verdichteten Basel, Lausanne und Genf, wo pro abgebrochene Wohnung 1,6- bis 2-mal so viele neue Wohnungen entstanden als in Zürich oder Bern.
Soziale Folgen der Verdichtung
Zwischen den Agglomerationen gibt es deutliche Unterschiede darin, wie häufig Langzeitmietende aufgrund eines Hausabbruchs oder einer Totalsanierung aus ihren Wohnungen verdrängt werden. Im Zeitraum von 2015 bis 2020 waren 0,08 Prozent der Wohnbevölkerung in der Agglomeration Genf und 1,02 Prozent in der Agglomeration Zürich davon betroffen. Insgesamt wurden in den Agglomerationen Genf und Lausanne trotz höherer Bautätigkeit weniger Personen verdrängt als in den Deutschschweizer Agglomerationen. Über alle Agglomerationen hinweg fanden die meisten betroffenen Personen (zwischen 43,6 und 64,1 Prozent) wieder eine Wohnung in der gleichen Gemeinde.
Eine Wohnungskündigung aufgrund eines Hausabbruchs oder einer Totalsanierung trifft vorwiegend Haushalte mit tieferen Einkommen. So hatten Haushalte, die ihre Wohnung verlassen mussten, ein um 30,5 bis 39,6 Prozent tieferes mittleres Einkommen als die Gesamtbevölkerung. Die Bewohnerinnen und Bewohner von Ersatzneubauten verfügten hingegen über ein um 14,6 bis 38,7 Prozent höheres mittleres Einkommen als die Gesamtbevölkerung. Besonders oft von Verdrängung betroffen sind Asylsuchende, anerkannte Flüchtlinge und Personen mit einem afrikanischen Geburtsland. Dies zeigt, dass die Verdrängung in den fünf untersuchten Agglomerationen der Schweiz vor allem Menschen betrifft, die wahrscheinlich Schwierigkeiten haben, wieder eine bezahlbare Wohnung zu finden.
Medienkontakt:
David Kaufmann
Assistenzprofessor für Raumentwicklung und Stadtpolitik, ETH Zürich
david.kaufmann@ethz.ch
Medien und Kommunikation BWO
media@bwo.admin.ch
+41 58 463 49 95
Wohnen gehört wie Nahrung, Bildung oder Gesundheit zu den Grundbedürfnissen der Menschen. Gestützt auf die Artikel 41, 108 und 109 der Verfassung setzt sich der Bund im Rahmen der Wohnungspolitik dafür ein, dass alle Bevölkerungsgruppen über eine angemessene Wohnung zu tragbaren Bedingungen verfügen.
Das Bundesamt für Wohnungswesen (BWO) ist die für den Vollzug der Wohnungspolitik des Bundes zuständige Fachbehörde. Es ist für die Umsetzung der Bundesgesetze verantwortlich, die das Parlament zur Erfüllung der wohnungspolitischen Verfassungsaufträge verabschiedet hat:
- Bundesgesetz über die Förderung von preisgünstigem Wohnraum (Wohnraumförderungsgesetz WFG) vom 21. März 2003 - Wohnbau- und Eigentumsförderungsgesetz (WEG) vom 4. Oktober 1974 - Bundesgesetz über die Verbesserung der Wohnverhältnisse in den Berggebieten vom 20. März 1970 (WS) - Obligationenrecht (Miete) vom 15. Dezember 1989 - Bundesgesetz vom 23. Juni 1995 über Rahmenmietverträge und deren Allgemeinverbindlicherklärung
Das BWO betreut zudem die Hypothekardarlehen, die gestützt auf den Bundesbeschluss vom 7. Oktober 1947 den Wohnbaugenossenschaften des Bundespersonals gewährt worden waren.
Das Amt vertritt die Schweiz in internationalen Organisationen, die sich mit Fragen des Wohnungswesens beschäftigen, namentlich im „Committee on Housing and Land Management“ der Europäischen Kommission für Wirtschaftsfragen der UNO (ECE).
| Bundesamt für Wohnungswesen BWO (Firmenporträt) | |
| Artikel 'Verdichtung und Verdrängung in den fünf grössten Schweizer Agglomerationen...' auf Swiss-Press.com |
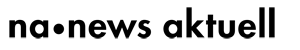

Die Ukraine kündigt ihren Ausstieg aus dem Ottawa-Vertrag an
Handicap International - Association nationale suisse, 02.07.2025Heilmittelplattform: Tiermedizin bleibt aussen vor
Gesellschaft Schweizer Tierärztinnen und Tierärzte, 02.07.2025Fokussierung bei der Sportproduktion
Schweizerische Radio- und Fernsehgesellschaft, 02.07.2025
15:12 Uhr 
Hauchdünner Sieg: Das ändert Trumps «Big Beautiful Bill» »
14:31 Uhr 
«Eine solche Bedrohungsdichte haben wir noch nie erlebt» »
12:12 Uhr 
Interview zur Schweizer Airline: Swiss fliegt «in eine neue Ära» ... »
19 Crimes Cabernet Sauvignon/Syrah South Eastern Australia
CHF 7.95 statt 9.95
Coop

19 Crimes Chardonnay South Eastern Australia - Chard
CHF 7.95 statt 9.95
Coop

19 Crimes Red Blend South Eastern Australia - The Banished
CHF 11.95 statt 14.95
Coop

Aargau AOC Blauburgunder Falkenkönig Weinkeller zum Stauffacher
CHF 7.95 statt 9.95
Coop

Aargau AOC Blauburgunder Falkenkönig Weinkeller zum Stauffacher
CHF 7.95 statt 9.95
Coop

Aargau AOC Müller-Thurgau Besserstein
CHF 14.35 statt 17.95
Coop

Aktueller Jackpot: CHF 2'569'703